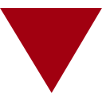" Die Zukunft vorzubereiten ist das, was wir alle hier tun, die öffentliche Instanz, die Mitarbeiter der Gedenkstätte und die Gedenkvereine aus allen Ländern, rund um die Werte, die uns die Überlebenden hinterlassen haben. Wir achten darauf, nur einen objektiven, aber kompromisslosen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, und behandeln sie als Erfahrungsfeld, dessen Analyse notwendig ist, um die richtigen Wege in die Zukunft zu finden. Schließlich teilen wir dieses Wissen auf möglichst angemessene Weise mit der jüngeren Generation, geleitet von der Idee des „Nie wieder“.
"
Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Lagers Dachau freut sich das Internationale Dachau-Komitee sehr, Sie zusammen mit dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Herrn Karl Freller, und der Leiterin der Gedenkstätte Dachau, Frau Gabriele Hammermann, begrüßen zu können.
Sie sind sehr zahlreich erschienen. Unter Ihnen sind viele Nachkommen von Opfern und Überlebenden, die aus vielen Ländern angereist sind. Vor allem fühlen wir uns durch die Anwesenheit von überlebenden Deportierten und Befreiern geehrt, die von ihren Angehörigen begleitet werden. Wir freuen uns auch über die Anwesenheit von Nachkommen von Befreiern und amerikanischen Kämpfern, zusammen mit Vertretern der 42. und 45. Division.
Im April 1945 gelang es den vereinten Anstrengungen dieser Einheiten, das Gebiet um die Stadt Dachau und schließlich das Lager Dachau zu befreien. Zuvor hatte sich im Lager angesichts der benachbarten unaufhörlichen Kämpfe und Bombenangriffe herumgesprochen, dass die Befreiung kurz bevorstand, oder im Gegensatz dazu befürchteten einige, dass das Lager zu einigen verhängnisvollen Zielen evakuiert werden würde.
In diesem Zusammenhang wurde unter der Leitung von Patrick O'LERAY das erste Internationale Häftlingskomitee mit den fähigsten Häftlingen gegründet, um bis zur Befreiung des Lagers die Sicherheit der Häftlinge vor den SS-Wächtern zu organisieren, falls diese versuchen sollten, das Lager zu evakuieren oder die Deportierten zu liquidieren.
Am 30. April kam es in dem endlich befreiten Lager zum besten Einvernehmen zwischen diesem Komitee und dem amerikanischen Kommando, um den Häftlingen erste Nothilfe zu leisten und die besten Bedingungen für ihre Rückführung in ihre Heimatländer zu gewährleisten. Viele starben noch in den folgenden Tagen, da ihr körperlicher Zustand so schlecht war. Am 8. Mai 1945 übernahm Arthur Haulot die Aufgaben von Patrick O'LERAY, der nach London gehen musste. Ende Juni 1945 war das Lager praktisch evakuiert.
Es ist ein wunderbares Glück, dass wir heute die Nachkommen der einen und der anderen zusammenbringen können. Eben noch lief der kleine Faden von Arthur Haulot mit dem Buch über die 40.000 Toten in Dachau und seinen Außenlagern dem Zug voraus.
Nach einer Intervention des CID beim Bund wurde das Gelände des verwahrlosten Lagers 1965 zur Gedenkstätte erklärt. Unter der Aufsicht des Freistaats Bayern entwickelte sich die Gedenkstätte über mehrere Etappen zu der Größe und dem Erfolg, den sie heute hat, mit jährlich einer Million Besuchern aus allen Nationen.
Im Jahr 2003 wurde die Bayerische Gedenkstättenstiftung gegründet, deren Tätigkeit sich als entscheidend für die Gedenkpolitik erwiesen hat, die allen Bevölkerungsgruppen offen steht, für die Gedenkstätte Dachau und die Gedenkstätte Flossenburg, und die sich allmählich bis zu den Überresten der Kommandos ausdehnt.
Ich erlaube mir diesen historischen Rückblick, um die Investition und den unermüdlichen Kampf aller an diesem Tag versammelten Akteure für die Erinnerungsarbeit an die größte Tragödie der Menschheit, die durch die Vorherrschaft der Ideale des Nationalsozialismus ausgelöst wurde, hervorzuheben.
Wir müssen auch die Bemühungen aller Teams würdigen, die an der Organisation dieses Treffens gearbeitet haben, mit vielfältigen Anliegen, die aber mit größter Sorgfalt gehandhabt wurden. Jahrestag der Gründung der Stiftung, der Gedenkstätte und all ihren Teams seine Dankbarkeit für all diese vergangenen und gegenwärtigen Investitionen im Namen der Freiheit und der Menschenwürde aus.
Die Ambitionen hören hier nicht auf, denn für die kommenden Jahre zeichnet sich bereits ein großes Projekt zur Umgestaltung dieser Gedenkstätte ab, das ehrgeizig und notwendig ist und für das wir alle Hoffnungen und die größten Erwartungen hegen. Dieses Projekt zeugt von der Beharrlichkeit aller, die sich für die Erinnerung einsetzen, und wird in Zukunft ein pädagogisches Instrument ersten Ranges für die neuen Generationen darstellen.
Dieses Projekt ist auch eine unverzichtbare Antwort auf die negationistischen Denkweisen, die immer häufiger die Geschichte neu beleuchten oder uns manchmal dazu auffordern, uns weniger mit der Vergangenheit zu beschäftigen und uns nur auf die Zukunft zu konzentrieren, deren Umrisse man fürchten könnte.
Die Zukunft vorzubereiten ist das, was wir alle hier tun, die öffentliche Instanz, die Mitarbeiter der Gedenkstätte und die Gedenkvereine aus allen Ländern, rund um die Werte, die uns die Überlebenden hinterlassen haben. Wir achten darauf, nur einen objektiven, aber kompromisslosen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, und behandeln sie als Erfahrungsfeld, dessen Analyse notwendig ist, um die richtigen Wege in die Zukunft zu finden. Schließlich teilen wir dieses Wissen auf möglichst angemessene Weise mit der jüngeren Generation, geleitet von der Idee des „Nie wieder“.
In den Köpfen der überlebenden Deportierten, und sie werden es gleich besser sagen als ich, beschränkt sich NIE WIEDER, wie man versucht sein könnte zu denken, nicht auf „Nie wieder Konzentrationslager, nie wieder Vernichtungslager, nie wieder Völkermord“.
Wenn man sich auf den Eid bezieht, den die ehemaligen Deportierten von Dachau am 29. April 1955 auf dem Leinteinberg ablegten, bedeutet „NIE WIEDER“ auch, und im Text, „Nie wieder ein Volk, das angegriffen und versklavt wird“, es bedeutet auch den Willen, „die Völker in Frieden zusammenzuführen, um ihre Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit zu gewährleisten“.
Der Eid erweist sich somit als ein gewaltiger Impuls für ein Vereintes Europa und eine freie Welt.
Seit 1945 gab es jedoch unaufhörlich Kriege von mehr oder weniger großem Ausmaß, wobei sich Zeiten der Spannung mit Zeiten des glücklichen oder relativen Friedens abwechselten. Man könnte meinen, dass die rote Linie des NIE WIEDER so hoch wie möglich angesetzt wurde, um alle Untaten darunter zuzulassen, die derzeit ihren Höhepunkt erreichen: Rückkehr der großen geopolitischen Blöcke mit territorialen und wirtschaftlichen Ambitionen, Grenzverletzungen, Manipulation und Desinformation der Bevölkerung, Xenophobie, Antisemitismus, Obskurantismus, soziale Gewalt, Bewährungsprobe für unsere Demokratien. In gewisser Weise kehren alle Bedrohungen und Übel zurück, gegen die jedoch eine Front ihre Einheit sucht und sich bemüht, Widerstand zu leisten.
Wenn wir uns heute hier versammeln, dann um an die wahre rote Linie zu erinnern, die von den überlebenden Deportierten gezogen wurde: die der Taten im Alltag, die der elementaren Rechte und deshalb auch die der Pflichten eines jeden, alles getragen von einer wahrhaft humanistischen, solidarischen und tugendhaften Vision.
Diese rote Linie auf ihrer elementarsten Ebene zu überschreiten, bedeutet, das Andenken aller Opfer dieses Lagers und seiner Kommandos zu überschatten, es bedeutet, das Andenken der Kämpfer zu überschatten, die ihr Leben für unsere Freiheit gegeben haben.
Die diesjährige Kranzniederlegung, die wir in wenigen Minuten beobachten werden, lädt Sie in einer neuen und symbolischen Formel dazu ein, in einer vereinten Front zu verweilen und die wahre Bedeutung der vor uns stehenden Inschrift „Nie wieder“ wiederzufinden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit